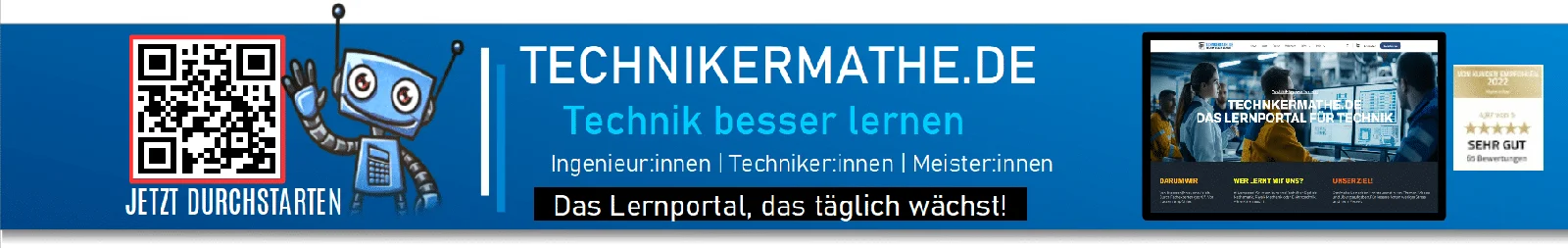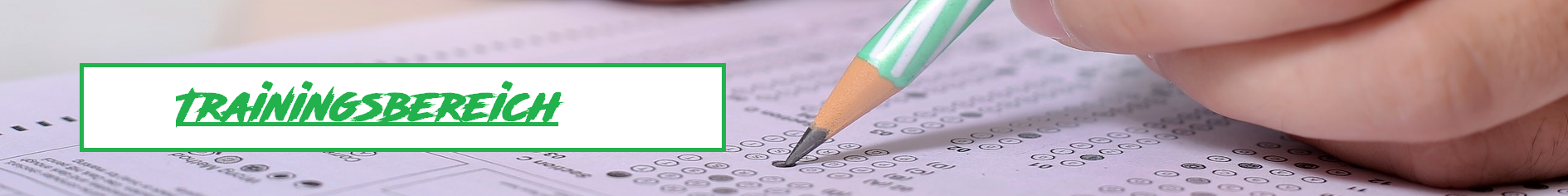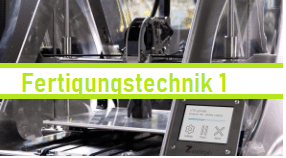In diesem Kurstext verschaffen wir dir einen Überblick zum Thema Zusätze in Kunststoff, die im Anschluss an Polyreaktionen eingesetzt werden.
“Zusätze werden genutzt, um das Verhalten von Kunststoffen oder die Erzeugung von Kunststoffen zu beeinflussen.”

Zusätze in Kunststoffen – Grundlegendes
Wenn eine Polyreaktion, wie beispielsweise die Polykondensation oder Polyaddition, erfolgreich abgeschlossen ist, liegt das Endprodukt (Polymer) meistens als körniges oder pulveriges Material vor.
Für eine Weiterverarbeitung eignet sich dieses Material nicht. Aus Sicht eines Technikers bedarf es Zusätzen, die eine Verarbeitung und einen späteren Gebrauch in Produkten ermöglichen.
Oft wird nicht ein einzelner, sondern eine Vielzahl von Zusätzen den Polymeren hinzugefügt, um aus einem Polymer-Rohstoff einen Polymer-Werkstoff entstehen zu lassen.
Videoclip – Zusätze in Kunststoffen
Im nächsten Video findest du noch mal eine Zusammenfassung des Kurstextes und zusätzliche Informationen zum Thema
Zusätze in Kunststoffen
Zusätze in Kunststoffen – Verfahren
Wir unterscheiden die Wirksamkeit von Zusätzen in die Zeit während der Erzeugung und nach der Erzeugung.
Konfektionieren
Beim Konfektionieren geht es in erste Linie darum das Polymer/Granulat hinsichtlich der Größe und Form anzupassen.
Compoundieren
Hier werden Zuschlagstoffe wie Additive oder Füllstoffe beigemengt. Hierzu verwendet man meistens Extruder. Das gesamte Compoundieren besteht aus insgesamt 7 Verfahrensschritten
- Fördern der Bestandteile
- Aufschmelzen
- Dispergieren
- Mischen
- Entgasen
- Druckaufbau
- Ausstoßen (Extrusion)
Mit dem Compoundieren können folgende Eigenschaften beeinflusst werden:
- Teilchengröße ändern: Hier werden pulvrige, großstückige oder fasrige Rohstoffe zu einer homogenen Masse verarbeitet. Diese Masse liegt als Granulat vor, dass sich für Spritzgussmaschinen eignet.
sowie
- Additive einarbeiten: Hier werden dem Polymer Additive in flüssiger oder fester Form (pulvrig, körnig, fasriger) zugeführt. Bleibt nach der Verarbeitung ein zweiphasiges Gemisch bestehen, spricht man von einem Verbundwerkstoffe (bsp. Granulat und Fasern).
sowie
- Störstoffe entfernen: Bevor das Gemisch weiterverarbeitet wird, ist es oft erforderlich diese zu trocknen und unter Umständen auch zu Entgasen. Bei letzterem werden niedermolekulare Begleitstoffe ausgetrieben.
Je nach Verfahren und Zweck haben sich unterschiedliche Zusätze bewährt. Die gängigsten Zusätze sind:
Zusätze in Kunststoff – in der Zeit während der Erzeugung
Der Einsatz von Zusätzen in einem Verfahren hat unterschiedliche Bezeichnungen:
Stabilisatoren
Stabilisatoren stabilisieren die Polymere in den weiteren Verarbeitungsschritten (z.B. Schmelzen) und sorgen dafür, dass ein thermisch oxidativer Abbau der Moleküle unterbunden wird. Auch nach der Herstellung haben Stabilisatoren einen Zweck (Siehe weiter unten).
Lösungsmittel
Diese Flüssigkeit besitzen einen vergleichsweise geringen Siedepunkt und erlauben es Kunststoff zur erweichen oder gleich ganz aufzulösen. Die chemische Zusammensetzung des Kunststoffs verändert sich dabei nicht.
Keimbildner
Keimbildner beschleunigen den Ablauf in Fertigungsverfahren und Reduzieren die Abkühlphasen, indem sie die Kristallisation vorantreiben.
Füllstoffe
Füllstoffe sind organische oder anorganische feste Zusätze, die keine Übereinstimmung mit dem Kunststoff, hinsichtlich Zusammensetzung und Struktur, haben.
Der mengenmäßige Anteil von Füllstoffen liegt bei
- Thermoplasten: 10 – 20 %
sowie
- Duroplasten: 20 – 60 %
sowie
- Elastomere: 20 – 60 %
- Kosten reduzieren durch weniger Material
 inaktive Füllstoffe (Gesteinsmehl, Papierfasern sowie Holzmehl)
inaktive Füllstoffe (Gesteinsmehl, Papierfasern sowie Holzmehl) - Mechanische Eigenschaften verbessern
 aktive Füllstoffe (Talkum und gefällte Kieselsäure)
aktive Füllstoffe (Talkum und gefällte Kieselsäure)
Gleitmittel
Gleitmittel garantieren eine nur minimale Reibung zwischen dem geschmolzenen Polymer und dem metallischen Werkstoff einer Maschine wie einem Extruder. Denn während der thermoplastischen Verarbeitung kommt es zu Wärme- und Reibungseinflüssen. Bewährt haben sich hier besonders Wachse und metallische Seifen.
Treibmittel
Diese Zusätzen kommen immer dann zum Einsatz, wenn Schaumstoffe (Dämmmaterial) aus Kunststoff hergestellt werden sollen. Es gibt auf dem Markt sowohl chemische und physikalische Treibmittel, als auch Gase, die unter hohem Druck das Material begasen oder Schaumschlagen.
Beispiele für gängige Treibmittel:
- chemische Treibmittel: Azo-Verbindungen und Sulfo-Hydrazide: spalten bei Hitze Stickstoff ab.
sowie
- physikalische Treibmittel: Halogenalkane (Frigen) und Kohlenwasserstoffe (Petrolether, Pentan): gehen als siedende Flüssigkeiten (bis 60°C) ein.
Zusätze in Kunststoff – in der Zeit nach der Erzeugung
Die Zeit nach der Erzeugung bezeichnet der Techniker als Gebrauchszeit.
Stabilisatoren
Stabilisatoren, die schon während der Herstellung aktiv waren, wirken der Alterung des Materials entgegen und senken die Entzündungsgefahr. Außerdem verleihen sie dem Material ein antistatisches Verhalten.
In erster Linie schützen Stabilisatoren Kunststoffe vor Veränderungen und Beschädigungen durch UV-Strahlung (Sonneneinstrahlung), welche den Kunststoff altern lässt. Diese Verschlechterung der Gebrauchseigenschaften ist nicht mehr umkehrbar.
Beispiele für gängige Stabilisatoren:
- Blei
sowie
- Cadmium
sowie
- Barium
sowie
- Ruß
Zusätze in Kunststoff – Weichmacher
Weichmacher werden Kunststoffen zugeführt, um die mechanischen Eigenschaften zu verbessern sowie eine Versprödung des Materials zu verhindern. Man unterscheidet die innere sowie äußere Weichmachung voneinander.
Bei Thermoplasten setzt man auf beides. So führt der Zusatz von niedermolekularen Produkten (äußere Weichmacher) oder die Anregung zur Bildung von kurzen Seitenketten (innere Weichmacher) dazu, dass der Glasübergangsbereich zu tiefen Temperaturen, also einem Bereich, in dem der Kunststoff definitiv nicht eingesetzt wird, verschoben.
Weichmacher sind schwer flüchtige Flüssigkeiten, deren Moleküle an die Kunststoffmoleküle durch Nebenvalenzen gebunden sind. Dabei haben sie einen Einfluss auf die Welchselwirkungskräfte zwischen den Makromolekülen indem sie die Erweichungstemperatur absenken. Dadurch sinkt auch die Sprödigkeit und Härte des Kunststoffs.
Beispiele für gängige Weichmacher:
- Phosporsäure,
sowie
- hochsiedende Ester der Phthalsäure
sowie
- Dioctylphthalat,
sowie
- Trichlorethylphosphat
Weichmacher haben in der Gesellschaft ein besonders negatives Image, da sie sich mit der Zeit dennoch verflüchtigen und an die Umgebung abgegeben werden. Dies ist für die Nutzung in Maschinen oder industriellen Bauteilen zumeist unproblematisch, jedoch in Spielzeugen von Kindern sind sie ein gewisses Gesundheitsrisiko.

Nicht ohne Grund steht auf Babyfläschchen frei von BPA.
Zusätze in Kunststoff: Farbstoffe
Zum Einfärben von Kunststoffen verwendet man in den meisten Fällen organische Farbstoffe, die eine hoche chemische und thermischen Beständigkeit besitzen, sowie anorganische Pigmente.
Die Einfärbung findet fast immer in der Zeit vor der Polymerisation statt, indem der Rohmasse die Farbstoffe zugeführt und das Gemisch anschließend homogenisiert wird. In seltenen Fällen ist auch eine Einfärbung der fertigen Produkte möglich, aber nur wenn es sich um wasserquellbares Material handelt.
Zusätze in Kunststoff: Flammschutzmittel
Flammschutzmittel haben die Aufgabe die Entflammbarkeit des Kunststoffes herabzusetzen. Es kommen hierbei unterschiedliche Wirkungsmechanismen zusammen:
- Die Zersetzung des Kunststoffs wird beeinflusst,
sowie
- Der Verbrennungsmechanismus wird gestört,
sowie
- Der Sauerstoff wird vom Brandherd abgeschirmt.
Beispiele für gängige Flammschutzmittel:
- Halogenverbindungen von Chlor
sowie
- Halogenverbindungen von Brom (besonders relevant!)
sowie
- Phosphorverbindungen
sowie
- Aluminiumhydroxid
sowie
- Halogenverbindung des Antimontrioxid (als Ergänzungsmittel zur Verstärkung)
Zusätze in Kunststoff – Antistatika
Dies sind leitende Stoffe, die den Kunststoffen zugesetzt werden, damit sich diese nicht elektrostatisch aufladen. Du kennst den Effekt doch bestimmt von Kindergeburtstagen aus deiner Vergangenheit, wenn alle Kids plötzlich die Luftballons an ihren Haaren reiben um sie anschließend an die Wand zu heften.
Beispiele für gängige Weichmacher:
- Polyglycolether
sowie
- Ammoniumverbindungen (quartäre)
Was gibt es noch bei uns?
Was ist Technikermathe.de?
Unser Dozent Jan erklärt es dir in nur 2 Minuten!
Interaktive Übungsaufgaben
Quizfrage 1
Wusstest du, dass unter jedem Kursabschnitt eine Vielzahl von verschiedenen interaktiven Übungsaufgaben bereitsteht, mit denen du deinen aktuellen Wissensstand überprüfen kannst?
Auszüge aus unserem Kursangebot
Hat dir dieses Thema gefallen? – Ja? – Dann schaue dir auch gleich die anderen Themen zu den Kursen
FT1 (Fertigungstechnik – Grundlagen) und
WT1 (Eigenschaften von Werkstoffen) an.
Perfekte Prüfungsvorbereitung für nur 19,90 EUR/Jahr pro Onlinekurs
++ Günstiger geht’s nicht!! ++
Oder direkt >> Mitglied << werden und >> Zugriff auf alle 22 Kurse << (inkl. >> Webinare << + Unterlagen) sichern ab 8,90 EUR/Monat
++ Besser geht’s nicht!! ++
Technikermathe.de meets Social-Media
Dein Technikermathe.de-Team