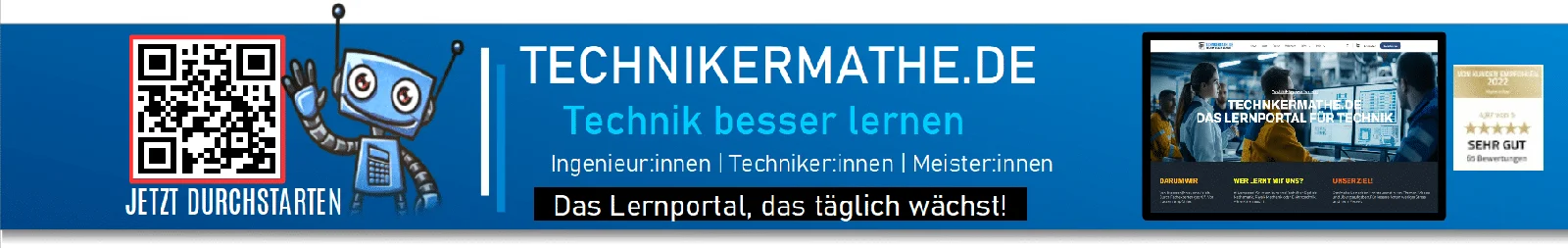Die Materialbedarfsplanung ist ein entscheidender Bestandteil des Produktionsprozesses und dient dazu, den Materialfluss effizient zu gestalten und Produktionsausfälle zu vermeiden. Dabei kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz, die sich je nach Art und Umfang des Materialbedarfs unterscheiden.

Was ist die Materialbedarfsplanung?
Definition
Die Materialbedarfsplanung ist ein wesentlicher Bestandteil der Produktions- und Logistikplanung. Sie umfasst die Ermittlung der benötigten Materialien, um eine geplante Produktion ohne Verzögerungen durchführen zu können. Dabei unterscheidet man verschiedene Bedarfsarten, die sowohl den Gesamtbedarf (Bruttobedarf) als auch den verfügbaren Bedarf (Nettobedarf) sowie primäre und sekundäre Anforderungen berücksichtigen.
Die Hauptziele der Materialbedarfsplanung sind:
- Sicherstellung der Materialverfügbarkeit
- Minimierung von Lagerkosten
- Vermeidung von Produktionsunterbrechungen
- Optimierung von Beschaffungsprozessen
Verfahren der Materialbedarfsplanung
Es gibt zwei grundlegende Verfahren: die plangesteuerte und die verbrauchsgesteuerte Materialbedarfsplanung. Beide Methoden haben ihre spezifischen Vorteile und Anwendungsbereiche.
1. Plangesteuerte Materialbedarfsplanung
- Funktionsweise:
Die plangesteuerte Materialbedarfsplanung basiert auf Produktionsplänen und Verkaufsprognosen. Sie nutzt Stücklisten und Produktionsaufträge, um den Bedarf vorherzusagen. - Anwendungsbereiche:
Besonders geeignet für A-Teile oder Endprodukte mit hohem Wert und stabiler Nachfrage. - Vorteile:
- Hohe Planungssicherheit.
- Optimal bei stabilen und langfristigen Produktionszielen.
- Nachteile:
- Wenig flexibel bei kurzfristigen Schwankungen.
- Erfordert präzise Daten und Prognosen.
Ein Automobilhersteller plant die Produktion von 10.000 Fahrzeugen im nächsten Quartal. Auf Basis der Produktionspläne werden alle benötigten Materialien wie Motoren, Reifen und Lacke vorherbestimmt.
2. Verbrauchsgesteuerte Materialbedarfsplanung
- Funktionsweise:
Die verbrauchsgesteuerte Materialbedarfsplanung stützt sich auf den tatsächlichen Materialverbrauch der Vergangenheit und prognostiziert den zukünftigen Bedarf. Häufig genutzte Instrumente sind Meldebestände, Bestellmengenverfahren und Sicherheitsbestände. - Anwendungsbereiche:
Besonders nützlich für B- und C-Teile sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. - Vorteile:
- Hohe Flexibilität bei kurzfristigen Schwankungen.
- Reduzierte Kapitalbindung durch kleinere Bestellmengen.
- Nachteile:
- Abhängigkeit von Vergangenheitswerten, wodurch unerwartete Nachfrageschwankungen nicht berücksichtigt werden können.
Ein Lebensmittelhersteller verwendet verbrauchsgesteuerte Planung für Verpackungsmaterial. Der Bedarf wird anhand der Verbrauchsmengen der letzten Monate berechnet.
Unterschiede zwischen plangesteuerter und verbrauchsgesteuerter Materialbedarfsplanung
| Merkmal | Plangesteuerte Planung | Verbrauchsgesteuerte Planung |
|---|---|---|
| Basis | Prognosen und Produktionspläne | Vergangene Verbrauchsdaten |
| Flexibilität | Gering | Hoch |
| Einsatzgebiet | A-Teile, Endprodukte | B- und C-Teile, Hilfsstoffe |
| Planungshorizont | Langfristig | Kurzfristig |
| Kapitalbindung | Höher | Niedriger |
Zusätzliche wichtige Begriffe in der Materialbedarfsplanung
- Primärbedarf: Bedarf an Endprodukten, die direkt an Kunden geliefert werden (z. B. Autos, Möbel).
- Sekundärbedarf: Bedarf an Rohstoffen, Baugruppen oder Vorprodukten, die zur Herstellung der Endprodukte erforderlich sind.
- Tertiärbedarf: Bedarf an Hilfs- und Betriebsstoffen, die nicht direkt in das Endprodukt eingehen (z. B. Schmierstoffe, Energie).
- Zusatzbedarf: Bedarf, der durch unvorhergesehene Ereignisse entsteht (z. B. Maschinenausfälle).
Mögliche Fragestellungen | Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Warum ist die Materialbedarfsplanung wichtig?
Sie verhindert Produktionsunterbrechungen, reduziert Lagerkosten und sorgt für eine optimale Materialverfügbarkeit.
Welche Daten sind für eine präzise Materialbedarfsplanung erforderlich?
Produktionspläne, Verkaufsprognosen, historische Verbrauchsdaten und Lagerbestände.
Wann sollte plangesteuerte Planung eingesetzt werden?
Bei stabiler Nachfrage, hoher Materialwertigkeit und langfristiger Produktionsplanung.
Wie wird der Sicherheitsbestand berechnet?
Sicherheitsbestand = (maximaler Verbrauch × maximale Lieferzeit) − (durchschnittlicher Verbrauch × durchschnittliche Lieferzeit).
Welche Softwaretools unterstützen die Materialbedarfsplanung?
ERP-Systeme wie SAP, Oracle oder Microsoft Dynamics sind gängige Lösungen, die komplexe Materialplanungsprozesse automatisieren können.
Zusammenfassung
Die Materialbedarfsplanung ist ein unverzichtbarer Prozess für die effiziente Produktionsgestaltung. Sie hilft, den Materialbedarf präzise zu planen, Engpässe zu vermeiden und die Lagerhaltung zu optimieren.
Während die plangesteuerte Planung auf stabilen Prognosen basiert und langfristige Ziele unterstützt, eignet sich die verbrauchsgesteuerte Planung besser für kurzfristige Anpassungen und kleinere Materialkomponenten.
Ein erfolgreiches Materialplanungskonzept berücksichtigt neben Primär- und Sekundärbedarf auch Tertiär- und Zusatzbedarf, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.
Wichtig: Eine präzise Planung und regelmäßige Anpassung an aktuelle Bedarfs- und Verbrauchsdaten sind der Schlüssel zu einem optimalen Materialmanagement.
Weitere gängige Verfahren in der Materialbedarfsplanung
Neben der plangesteuerten und verbrauchsgesteuerten Materialbedarfsplanung gibt es weitere Ansätze, die je nach Anforderungen und Unternehmensstruktur zum Einsatz kommen:
1. Bedarfsgesteuerte Materialbedarfsplanung (Just-in-Time-Planung) [Just-in-Time-Materialplanung]
- Funktionsweise:
Die Materialbereitstellung erfolgt exakt zum Zeitpunkt des Bedarfs, um Lagerkosten zu minimieren. - Vorteile:
- Sehr niedrige Lagerkosten.
- Hohe Flexibilität bei Nachfrageschwankungen.
- Nachteile:
- Hohe Abhängigkeit von Lieferanten und Transportketten.
- Risiko bei Lieferverzögerungen.
Ein Elektronikunternehmen nutzt Just-in-Time-Planung, um nur die benötigten Mikroprozessoren für die Tagesproduktion zu bestellen, wodurch Lagerkosten eingespart werden.
2. Kanban-System [Kanban-System Materialbedarf]
- Funktionsweise:
Ein visuelles Steuerungssystem, das auf Karten oder Signalen basiert, um den Materialnachschub auszulösen. Häufig in der Lean Production verwendet. - Vorteile:
- Gute Übersicht über Materialflüsse.
- Vermeidung von Überproduktion.
- Nachteile:
- Weniger effektiv bei komplexen Produktionsprozessen mit variabler Nachfrage.
In einem Produktionswerk signalisiert eine leere Kanban-Karte am Lagerort, dass neues Material bestellt werden muss.
3. Heuristische Verfahren
- Funktionsweise:
Diese Methode basiert auf Erfahrungswerten und Schätzungen, anstatt auf festen Daten oder Algorithmen. - Vorteile:
- Schnell umsetzbar.
- Hilfreich bei unvorhersehbaren Situationen.
- Nachteile:
- Weniger präzise.
- Risiko von Fehleinschätzungen.
Ein Handwerksbetrieb schätzt den Materialbedarf für ein großes Projekt basierend auf bisherigen Erfahrungswerten ähnlicher Projekte.
4. MRP (Material Requirements Planning)
- Funktionsweise:
Ein computergestütztes System, das auf Produktionsplänen, Stücklisten und Lagerbeständen basiert. Es berechnet, wann und in welcher Menge Materialien benötigt werden. - Vorteile:
- Automatisierung und Präzision.
- Integration in größere ERP-Systeme möglich.
- Nachteile:
- Hohe Implementierungskosten.
- Abhängigkeit von Software.
Ein Automobilhersteller verwendet MRP, um den Bedarf an Bauteilen wie Motoren und Getrieben zu planen und Bestellungen automatisch auszulösen.
Ergänzende wichtige Informationen
-
Trends in der Materialbedarfsplanung:
- Künstliche Intelligenz (KI): KI-gestützte Systeme analysieren historische Daten und erkennen Muster, um Bedarfsprognosen noch genauer zu machen.
- Big Data: Durch die Analyse großer Datenmengen können saisonale Schwankungen oder Markttrends frühzeitig erkannt werden.
- Nachhaltigkeit: Umweltfreundliche Materialbeschaffung wird zunehmend in die Planung integriert, um CO₂-Emissionen zu reduzieren.
-
Herausforderungen der Materialbedarfsplanung:
- Unsicherheiten in Lieferketten (z. B. durch geopolitische Konflikte oder Pandemien).
- Volatile Nachfrage, insbesondere bei saisonalen Produkten.
- Kostensteigerungen bei Rohstoffen.
Weitere Begriffe in der Materialbedarfsplanung
- Dispositionsverfahren: Methoden zur Steuerung des Materialflusses, die bedarfs- oder verbrauchsorientiert arbeiten.
- Losgrößenplanung: Bestimmung der optimalen Bestell- oder Produktionsmenge unter Berücksichtigung von Kosten und Nachfrage.
- ABC-Analyse: Ein Klassifizierungsverfahren, das Materialien nach ihrem Wert und ihrer Verbrauchsmenge ordnet, um den Fokus auf wichtige Komponenten zu legen.
Weitere mögliche Fragestellungen | Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was ist der Unterschied zwischen Just-in-Time und Kanban?
Just-in-Time konzentriert sich auf die Lieferung genau zum Zeitpunkt des Bedarfs, während Kanban ein visuelles Steuerungssystem ist, das den Nachschub organisiert.
Welche Vorteile bietet KI in der Materialbedarfsplanung?
KI kann Bedarfsprognosen optimieren, Anomalien erkennen und Entscheidungen automatisieren, was die Effizienz steigert.
Was sind typische Fehler in der Materialbedarfsplanung?
Falsche Bedarfsprognosen, unzureichende Sicherheitsbestände und mangelnde Kommunikation mit Lieferanten.
Wie wirkt sich Nachhaltigkeit auf die Materialbedarfsplanung aus?
Unternehmen achten verstärkt auf umweltfreundliche Lieferanten, recycelbare Materialien und ressourcenschonende Prozesse.
Wie unterscheidet sich die Materialbedarfsplanung in der Produktion und im Handel?
In der Produktion wird Material für die Fertigung geplant, während im Handel der Fokus auf Lagerbeständen und Verkaufsprognosen liegt.
Zusammenfassung 2
Die Materialbedarfsplanung ist ein komplexer, aber unverzichtbarer Prozess, der zahlreiche Verfahren und Ansätze umfasst. Neben den klassischen plangesteuerten und verbrauchsgesteuerten Methoden bieten moderne Ansätze wie Just-in-Time, Kanban oder KI-gestützte Planung innovative Möglichkeiten, den Materialfluss effizient zu gestalten.
Ein tiefes Verständnis der Methoden, ergänzt durch aktuelle Trends wie Nachhaltigkeit und Big Data, ist der Schlüssel zu einer optimalen Materialverfügbarkeit, geringeren Kosten und einer reibungslosen Produktion.
Was gibt es noch bei uns?
Optimaler Lernerfolg durch tausende Übungsaufgaben

Quizfrage 1
Quizfrage 2
“Wusstest du, dass unter jedem Kursabschnitt eine Vielzahl von verschiedenen interaktiven Übungsaufgaben bereitsteht, mit denen du deinen aktuellen Wissensstand überprüfen kannst?”
Was ist Technikermathe?
Unser Dozent Jan erklärt es dir in nur 2 Minuten!
Oder direkt den > kostenlosen Probekurs < durchstöbern? – Hier findest du Auszüge aus jedem unserer Kurse!
Geballtes Wissen in derzeit 26 Kursen
Hat dir dieses Thema gefallen? – Ja? – Dann schaue dir auch gleich die anderen Themen zu den Kursen
WT3 (Werkstoffprüfung) und
TM1 (Technische Mechanik – Statik) an.
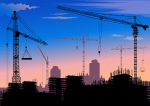
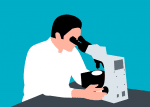
Perfekte Prüfungsvorbereitung für nur 14,90 EUR/Jahr pro Kurs
++ Günstiger geht’s nicht!! ++
Oder direkt Mitglied werden und Zugriff auf alle 26 Kurse (inkl. Webinare + Unterlagen) sichern ab 7,40 EUR/Monat ++ Besser geht’s nicht!! ++
Social Media? - Sind wir dabei!
Dein Technikermathe.de-Team